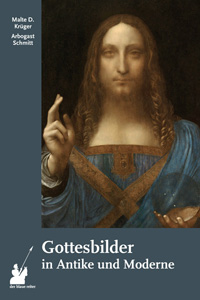| Gottesbilder in Antike und Moderne |
Leseprobe
Memoria Dei.
Über die Möglichkeit theologischen Wissens
Arbogast Schmitt zum 24. April 2023
Then out spoke brave Horatius, the Captain of the Gate:
To every man upon this earth, death cometh soon or late;
And how can man die better than facing fearful odds,
For the ashes of his fathers, and the temples of his Gods.
Thomas Babington Macaulay, Horatius at the Bridge
Der Marburger Gräzist Arbogast Schmitt verweist in seiner Studie „Gibt es ein Wissen von Gott? Plädoyer für einen rationalen Gottesbegriff“ (2019) darauf, dass in der Moderne die Überzeugung gängig ist: „An Gott kann man glauben […], Gott ist aber kein Gegenstand eines möglichen Wissens.“ Schmitt macht im Gegenzug auf die Einsichten der sich insbesondere von Aristoteles herschreibenden Tradition der Antike aufmerksam, dass der Gottesgedanke als grundlegend für die Vernunft gilt. Erst mit dem spätmittelalterlichen Nominalismus und dann mit der europäischen Aufklärung ist nach Schmitt die Vernunft so verstanden worden, dass sie als genuiner Ort der Gotteserkenntnis ausscheidet. So wird das Gottesbild nach Schmitt von der Vernunft getrennt und das Gefühl als Ort der Gotteserkenntnis ausgemacht. Vorausgesetzt wird hierbei in der Moderne freilich, dass – anders als bei Aristoteles – Gefühl und Denken grundlegend verschiedene Sphären sind, wie Schmitt an anderer Stelle unterstreicht. Mit diesem modernen Gefühlsbegriff ist offenkundig die Tendenz verbunden, das Gottesbild von der Rechenschaftsfähigkeit der Vernunft zu lösen und es der nur bedingt aufklärbaren Entscheidung des Einzelnen zu überantworten. Für Schmitt wird damit sowohl dasjenige, was Aristoteles vielschichtig und vernünftig über Gefühl und Wahrnehmung zu sagen weiß, wie auch die rationale Dimension des Gottesbildes verfehlt. Hierbei hat Schmitt insbesondere die Fortschreibungen, Umbesetzungen und Spannungen zwischen Denkfiguren aus der Antike und der Moderne kritisch im Blick, wie er sie schon in seiner großen Studie „Die Moderne und Platon. Zwei Grundformen europäischer Rationalität“ (2/2008) dargelegt hat.
Im Folgenden soll in gewisser Weise daran angeknüpft werden, indem in eigener Verantwortung unter Aufnahme moderner und antiker Einsichten drei grundlegende Thesen zur Frage eines möglichen Wissens von Gott vertreten werden sollen. Sie besagen das Folgende. Erstens ist im Kontext der Bewusstseinstheorie die These plausibel, dass es keine Selbsterkenntnis ohne Erinnerung gibt: Um sich selbst erkennen zu können, muss der Mensch wissen, wer er ist; und ohne Erinnerung ist dies unmöglich. Zweitens ist im Kontext der Erinnerungstheorie die These plausibel, dass es keine Erinnerung ohne Bildlichkeit gibt: Die Erinnerung ist in bestimmter Hinsicht bildlich, ohne dass damit eine rein passive oder sogar mechanische Abdrucktheorie gemeint wäre. Und drittens ist im Kontext der Bildtheorie die These plausibel, dass es keine Bildlichkeit ohne den Gottesgedanken gibt: Die Bildlichkeit hat eine Tendenz zu Ganzheit und Überschreitung, deren Zusammenspiel sich im Gottesgedanken verdichtet.
Zur Einordnung dieser drei Thesen sei noch dreierlei vorausgeschickt, nämlich zur Position, zur Methode und zur Argumentation. Positionell wird im Folgenden kein Gottesbeweis vertreten. Vielmehr wird die Überzeugung plausibilisiert, dass dem Menschen notwendigerweise die Möglichkeit des Gottesgedankens zukommt. Daher ist der Mensch berechtigt, ein anschauliches Gottesbild auszuprägen, das sich kritisch an diesem möglichen Wissen von Gott messen lassen muss. Methodisch kommt im Folgenden – weder der „Logik“ letztlich zufälliger Praxisgläubigkeit noch angeblich zwingender Beweisverfahren verpflichtet – eine diagnostische Vernunft zum Zug, die im Ausgriff auf dasjenige, was verstanden werden soll, ihre Grenzen hat. Es gibt insofern keine Vernunft ohne den Bezug auf etwas. Argumentativ gilt für das Folgende, dass Einsichten widerlegt sind, wenn sie nicht triftig sind; der bloße Hinweis auf ihr Alter besagt nichts. Vergangene Einsichten nicht zu kennen, muss kein Erkenntnisfortschritt sein, so wenig aktuelle Diskurse zwingend bloß Bisheriges wiederholen. Doxographischer Kontext und argumentative Geltung gehören sinnvollerweise zusammen. Entsprechend gliedern sich die folgenden drei Abschnitte dieses Beitrags zur Bewusstseinstheorie, Erinnerungstheorie und Bildtheorie. Es folgt jeweils nach einer (1) phänomenal akzentuierten Einführung (2) ein doxographischer Diskurszusammenhang, um (3) schließlich eine bestimmte Position argumentativ zu vertiefen. Ganz am Schluss dieses Beitrags findet sich eine kurze Zusammenfassung mit Selbsteinwänden und einem Ausblick. …
Autor: Malte Dominik Krüger
Das Gottesbild in der Antike – eine Verteidigung seiner Wissenschaftlichkeit
I. Zur Abgrenzung des Rationalitätsbegriffs in der platonisch-aristotelischen Tradition von modernen Bewusstseinbegriffen
1) Der Bezug auf eine göttliche Vernunft als Aufklärung des Denkens über sich selbst
Wenn man sich mit dem Gottesbild in Antike und Moderne beschäftigt, trifft man auf bemerkenswert unterschiedliche Überzeugungen: Gott oder das Göttliche galt für viele alte Denker als die feste Grundlage sicheren Wissens, in der Moderne spricht man eher von einem Glauben an Gott, der beginnt, wo das Wissen endet.
Für Platon und Aristoteles war Philosophie immer zugleich Theologie. Die Theologie war nicht nur das erstrebte Ziel der Philosophie, sie galt als die Basis ihrer Wissenschaftlichkeit. Das, was das Denken aus sich selbst und von sich her weiß, sei, dass es seine Kriterien in einer allgemeinen, für alle gleich verbindlichen Vernunft suchen müsse. Diese eine Vernunft für alle und alles könne man nur als ein über sich selbst verfügendes denkendes Wesen verstehen, d.h. nur als Person (oder als etwas, das Person-Sein begründet), die deshalb auch mit einem Namen bezeichnet werden kann: als Gott.
Die meisten Philosophen der griechisch-römischen Spätantike und ebenso die arabischen, jüdischen, byzantinischen Philosophen und Theologen bis ins hohe Mittelalter folgten Platon und v.a. Aristoteles in dieser Auffassung und gaben sie auch an das lateinische, christliche Mittelalter weiter. Gut 1500 Jahre lang galt sie als Aufklärung des Denkens über sich selbst.
Zu diesem Selbstverständnis der Philosophie gab es allerdings bereits in der Antike in der Zeit zwischen 300 v. Chr. und ca. 100 n. Chr. eine Gegenbewegung durch die Schulen der Skeptiker, Stoiker und Epikureer. Es waren diese Schulen, auf die in einer breiten Rückwendung bereits viele Theoretiker der beginnenden Moderne (seit dem 14. Jahrhundert) zurückgriffen. Quelle des Wissens war für sie alle nicht eine abstrakte, vielleicht göttliche Vernunft, Beginn und Ursprung des Wissens konnten nur die wirklichen, sinnlich erfahrbaren Dinge selbst sein. Diese sogenannte ‚Wende zu den Dingen‘ ist in erster Linie eine Wende gegen Aristoteles. Ihm wurde vorgehalten, er habe die Welt aus bloßen Begriffen erklären wollen und habe alles Wissen auf eine reine Buchgelehrsamkeit beschränkt.
2) Die ‚Wende zu den Dingen‘ als Abwendung von einer ‚aristotelischen‘ Rationalität
Aus der Abneigung gegen Aristoteles, die in der Regel auf das ganze Mittelalter ausgedehnt wurde, entwickelte sich das Bewusstsein, in einer neuen Zeit zu leben. Das Charakteristikum dieser neuen Zeit ist eine neue Form empirisch begründeter Wissenschaftlichkeit. In ihr gibt es eine breite Übereinstimmung darüber, dass alles Wissen nur durch Beobachtung und Analyse der Dinge selbst gewonnen werden kann und an ihnen auch wieder überprüft, ‚verifiziert‘ werden muss.
Wenn alle Begriffe zuletzt aus der Beobachtung der Dinge selbst stammen, kann man auch nur etwas über diese Dinge und deren untersuchbare Zusammenhänge wissen. Gott ist in diesem Verständnis von Wissenschaft kein möglicher Gegenstand des Wissens. Man kann es zwar für ein natürliches Bedürfnis der menschlichen Vernunft halten, dass wir nicht nur einzelne Dinge, einzelne Zusammenhänge kennen wollen, sondern auch eine Erkenntnis der Ordnung des Ganzen haben möchten, in der alle Einzelerkenntnisse ihren vielleicht letzten Grund haben. So hatte Kant gedacht, es sind ihm sogar einige große Physiker gefolgt. Es wäre aber, wie uns Kant warnt, eine unzulässige Konzession an eine Verführung des Denkens, aus einem letzten Ordnungsprinzip, von dem man gar kein konkretes Wissen haben kann, Folgerungen über das Sein der Dinge in der Welt zu ziehen. Man kommt schon durch den bloßen Gedanken, dass alles in der Welt eine feste, determinierte Ordnung hat, in Konflikt mit den Phänomenen. Dass es nicht nur Ordnung gibt, sondern auch viel Unordnung, Unregelmäßiges, Zufälliges, Zerstörendes usw., ist nicht zu bestreiten. Man kann wohl nicht einmal den Schluss ablehnen, dass es gar kein Ordnungsprinzip in der Welt gibt, sondern dass alle vorfindbaren Einzelordnungen Produkt des Zufalls und zufälliger Änderungen (Mutationen) sind.
3) Über ein methodisches Grunddefizit im neuzeitlichen Empirismus:
die Vernachlässigung der Unterscheidung der sinnlichen Erscheinung der Dinge von ihrem begreifbaren Sein
Von Nicolaus Cusanus gibt es das schöne Wort, dass man die Philosophen nur versteht, wenn man zuerst nach dem Gemeinsamen unter ihnen fragt. Ein solches Gemeinsames gibt es auch unter den gegensätzlichen Auffassungen über ein mögliches Wissen von Gott, über die wir gerade sprechen. Warum kann man nicht einfach den Begriffen und Hypothesen, die wir über die Dinge der Welt bilden, folgen? Offenbar weil wir nicht wissen wollen, was sich jemand, auch wenn er noch so klug ist, über etwas ausdenkt, sondern was etwas wirklich ist.
Das ist der überzeugende Grund, weshalb das Prinzip omnis cognitio incipit a sensibus in den meisten antiken wie modernen Philosophien geteilt wird. …
Autor: Arbogast Schmitt
Redaktioneller Hinweis: Die Fußnoten sind in den obigen Auszügen nicht dargestellt. Diese finden Sie jedoch in den „Leseproben im Buch-Layout“ (siehe Downloads in der linken Spalte).