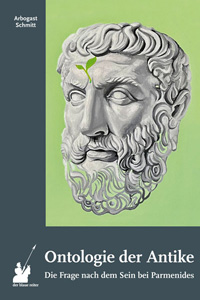| Ontologie der Antike I |
Leseprobe
Vorwort
Erkennen, was etwas wirklich ist: Das ist ein Anliegen nicht nur der Philosophie. Es ist eine Bedingung, die für jede Art von Handeln und Leben erfüllt oder wenigstens teilweise erfüllt sein muss. Ein Leben in einem selbsterzeugten Schein lässt sich bestenfalls als Zufallsprodukt führen.
Die Frage nach dem Sein, mit der man eine Antwort sucht über das, was die Welt von sich her und nicht nur in unseren Vorstellungen über sie ist, wurde in der Geschichte der europäischen Philosophie zuerst von den heute sogenannten Vorsokratikern gestellt. Für viele beginnt die Reflexion auf die Bedingungen, wie man das Sein von etwas erkennen kann, besonders mit Parmenides. Platon und Aristoteles haben an seine Grundlegungen angeknüpft und in methodisch sorgfältigen Analysen systematisch zu entwickeln versucht, wie man bei verschiedenen Gegenständen, zum Beispiel physikalischen, ethischen, ästhetischen, künstlichen, theoretischen usw., deren Sein erschließen kann, um schließlich allgemein zu erfassen, an welchen Kriterien man das Sein von etwas erkennt und von Akzidenzen, die von der Sacherkenntnis ablenken, unterscheidet.
Mit ihren Lösungen haben sie die besten Denker der griechisch-römischen Spätantike, die persisch-arabisch-jüdischen Philosophen und die Theologen des Abendlandes bis zum Beginn der Neuzeit so überzeugt, dass es in allen diesen verschiedenen Epochen, Kulturen und Religionen zwar viele Veränderungen, Differenzierungen, Verbesserungen im Detail gegeben hat, aber keine Infragestellung des Systems im Ganzen.
Zwar gab und gibt es seit der Zeit der Renaissance und bis in die Gegenwart ein reiches Interesse an vielen Aspekten dieser antik-mittelalterlichen „Ontologie“: Seit dem Nominalismus des späten Mittelalters aber ist eine Zustimmung zu dem System als Ganzem kaum mehr möglich. Wer ihm zustimmt, fällt scheinbar hinter den erreichten Standpunkt der Moderne zurück in eine metaphysische Weltdeutung, an die man glauben, von der man aber kein kritisches Wissen haben kann.
Bis in die Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts wurde jeder, der ein Studium der Philosophie oder einer anderen Geisteswissenschaft begann, über die grundlegenden Unterschiede zwischen „der“ Antike und „der“ Moderne unterrichtet. Man lernte vor allem, dass das Denken der Antike (und des ihr folgenden Mittelalters) nach außen, auf die vorstellbaren Dinge der Welt und deren Ordnung gerichtet gewesen sei, erst die Moderne habe sich auf das Denken selbst zurückgewendet. Erst durch diese Wende wissen wir, dass wir nicht die Ordnung der Dinge, wie sie an sich ist, erkennen können, sondern nur die Weise, die „Modi“, wie wir sie – durch unsere Sinne und unser Denken – herstellen.
Wer einmal zu diesem kritischen Denken erzogen ist, sollte sich aber auch der Aufgabe nicht entziehen, zu prüfen, ob nicht auch seine (oft sehr abstrakten) Beobachtungen antiker Texte auf subjektiven Konstruktionen beruhen. Woher wissen wir eigentlich, dass die Denker der Antike das Werkzeug, den Verstand, mit dem sie die Welt untersucht haben, nicht auch selbst einer Untersuchung unterzogen haben? Immerhin gibt es nicht nur einige, sondern sehr viele antike Texte, in denen das Denken selbst, rein für sich, in seinen verschiedenen Aktmöglichkeiten – bei der Bildung von Wahrnehmungen, Vorstellungen, Meinungen, Urteilen und schließlich einheitlicher Vernunftbegriffe – behandelt wurde.
Fragt man nach, weshalb alle diese Analysen nicht als „Wende des Denkens auf sich selbst“ gelten, findet man über die Jahrhunderte hin eine und dieselbe Antwort, die sich tatsächlich auf einen auffälligen, aber vielleicht doch zu auffälligen Befund stützt: Es gibt selbst bei Platon und Aristoteles keinen Begriff von Bewusstsein oder mentaler Repräsentation und auch keine Erklärung der Modi, in denen das Denken die ihm durch die Sinne oder andere unmittelbare Erlebnisformen (Intuition, Gefühle usw.) gegebenen Gegenstände mit seinen eigenen Akten verdeutlicht und sich über sie „aufklärt“. Auch in der Spätantike und im orientalischen oder abendländischen Mittelalter sind bestenfalls Spuren eines Wissens über die subjektiven Herstellungsbedingungen gegebener Gegenstände durch das Bewusstsein nachweisbar. Dort, wo von Akten, die bewusstseinsähnliche Repräsentationen beschreiben, die Rede ist, gelten sie als Begleitformen des Denkens, nicht als Denken selbst.
…
Die Grundprobleme einer „Lehre vom Sein“ – ein kritischer Überblick
Aristoteles beginnt seine Metaphysik mit der Feststellung: „Alle Menschen streben nach Wissen, von ihrer Natur her.“ Das zeige sich an der Liebe zum Wahrnehmen, vor allem mit den Augen. Denn sie gäben uns viel zu erkennen und offenbarten viele Unterschiede (980a1–7).
Aristoteles formuliert damit gleich im ersten Satz ein Grundanliegen der Form von Metaphysik, wie wir sie in der Regel der Antike zuschreiben. Ihr Ziel sei die Erkenntnis der Welt, wie sie (an sich selbst) ist und wie sie sich der Anschauung offenbart. Mit dieser Zielsetzung orientiere sie sich am Alltagsdenken und an der Alltagssprache und erfülle dadurch ein menschliches Grundbedürfnis. Denn niemand will allein in die Welt seiner Vorstellungen eingeschlossen sein, sondern will erkennen was ist, das heißt, was die Dinge, die uns umgeben und mit denen wir leben, wirklich sind. Wer wissen möchte, ob ein Nahrungsmittel bekömmlich oder giftig ist, möchte eine mit der Wirklichkeit übereinstimmende Antwort, keine Auskünfte, die nur auf subjektiven Vorstellungen oder Gefühlen beruhen.
Diesem natürlichen Bedürfnis nach einem Verständnis der Welt, wie sie wirklich ist, steht aber seit Beginn der Moderne ein intensivierter kritischer Vorbehalt gegenüber. Wenn man wissen will, was die Dinge wirklich sind, kann man nicht einfach die Dinge, so wie sie sich uns zeigen, untersuchen, man muss auch die Vermögen des Wahrnehmens und des Denkens, mit denen wir solche Untersuchungen machen, zum Gegenstand einer Überprüfung machen. Spätestens seit Kant sind wir darüber belehrt, dass bereits von unseren Wahrnehmungen nicht sicher ist, ob sie uns die Dinge genauso zeigen, wie sie an sich sind. Denn wir nehmen alle Dinge im Nebeneinander des Raums und im Nacheinander der Zeit wahr. Deshalb muss man zumindest damit rechnen, dass die raumzeitliche Vorstellung der Dinge etwas ist, womit wir diese schon von uns aus, a priori, ordnen und formen. Diese Ordnung hängt nicht von der Besonderheit der einzelnen Wahrnehmungen ab, die wir von den Dingen machen. Wir können reflexiv feststellen, dass jede unserer Wahrnehmungen raumzeitlich geordnet ist, und daraus schließen, dass diese Ordnung nicht von den Dingen kommt, sondern von uns bei jeder Wahrnehmung schon mitgebracht wird. Deshalb wissen wir nicht, ob die Dinge selbst räumlich und zeitlich geordnet sind, wir wissen nur, dass sie uns auf diese Weise erscheinen. Dasselbe gilt von den Kategorien, in denen wir diese Erscheinungen denken. Ob das „Beharrende in der Zeit“ wirklich als die Substanz der Dinge gedeutet werden darf, ist in derselben Weise einem skeptischen Zweifel unterworfen wie die Formen, in denen wir die Dinge wahrnehmen. Man muss damit rechnen, dass die Annahme einer Substanz in den Dingen nur einem subjektiven Ordnungsbedürfnis entspricht. Ob jedes Ding an sich eine Substanz hat, wissen wir nicht.
Der historischen Gerechtigkeit zuliebe muss man darauf hinweisen, dass die ‚kritische‘ Überzeugung, dass wir die Dinge nicht, wie sie sind, sondern nur, wie sie uns erscheinen, wahrnehmen und beurteilen, schon von den Skeptikern der Antike geteilt wurde. Sie hatten diese Skepsis auch ausführlich begründet und viele Modi, von ihnen sogenannte Tropen, aufgewiesen, die dazu führen, dass wir nur die Erscheinungsformen der Dinge, nicht ihr wirkliches Sein erkennen können. Diese antike Skepsis war noch radikaler als die Kritik von Kant. Er setzte sich vor allem mit der Form der Skepsis, wie sie Hume in Wiederaufnahme der antiken Skepsis ausgebildet hatte, auseinander und versuchte mit seiner Kritik unserer Erkenntnisvermögen der Sinnlichkeit und des Verstandes diese Skepsis wenigstens abzumildern: Auch wenn wir nicht wissen, ob die Dinge selbst raumzeitlich und kategorial bestimmt sind, wissen wir aus einer reflexiv-kritischen Untersuchung der Leistungen unserer Erkenntnisvermögen, dass wir alle über die gleichen Ordnungskriterien beim Wahrnehmen und Denken verfügen. Deshalb dürfen wir folgern, dass unser transzendentaler Apparat kein Produkt privat-subjektiver Vorstellungen herstellt, sondern etwas, das alle Erkennenden gemeinsam anwenden oder anwenden können. Dieses Gemeinsame nennt Kant „objektiv“, nicht weil er es den Dingen an sich zuschreibt, sondern weil es für alle erkennenden Subjekte gilt und daher nicht privat, sondern wissenschaftlich allgemeingültig ist.
…
Die „Leseprobe im Buch-Layout“ (siehe linke Spalte) enthält auch Auszüge aus dem zweiten Abschnitt des Buchs, „Parmenides’ Lehrgedicht“.